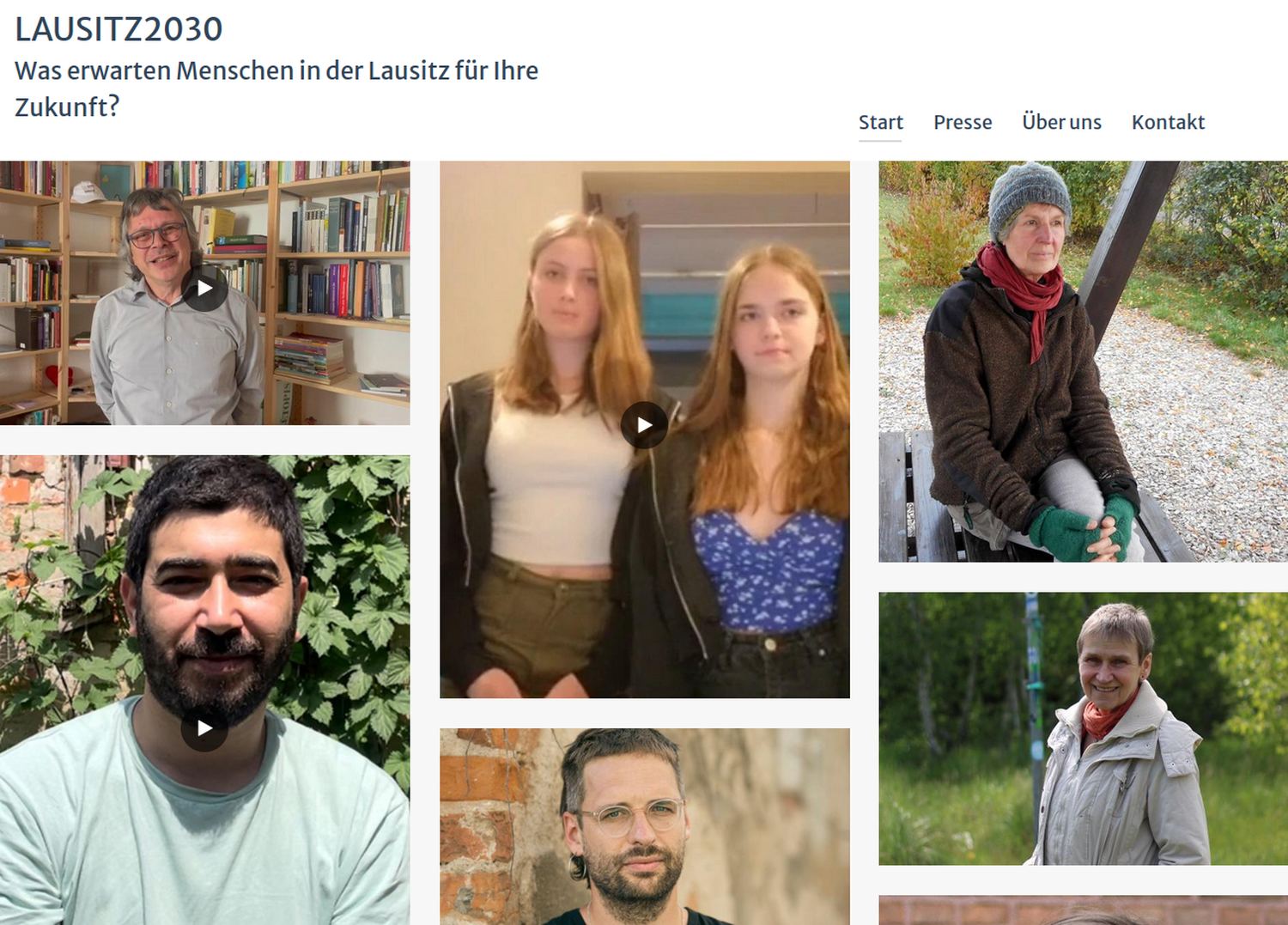Energiepolitik
Hier gibt es regelmäßig aktualisierte Meldungen zur Energiepolitik mit Schwerpunkt auf die Lausitzer Kohle.
Kommentar: Was man zum „Kohlekonsens“ nicht vergessen sollte
Seit der Veröffentlichung des Ampel-Sondierungspapiers mit seinem butterweichen „idealerweise“ auf 2030 vorzuziehenden Kohleausstieg mahnen nicht wenige altbekannte Lausitzer Akteure davor, den in der Kohlekommission erreichten „gesellschaftlichen Konsens“ nicht aufzukündigen. Klingt erstmal nachvollziehbar, oder? Hier ist Denken in Zusammenhängen gefragt, an die kurz erinnert werden soll.
Nicht nur, dass die Staatskanzleien der Kohleländer 2018/19 hinter den Kulissen mehr Einfluss hatten als die offiziell stimmberechtigten Mitglieder auf der Showbühne Kohlekommission. Nicht nur, dass im Kohleausstiegsgesetz zugunsten der Braunkohle von den Empfehlungen der Kommission abgewichen wurde, wie acht Kommissionsmitglieder deutlich zu verstehen gaben. Das Problem liegt tatsächlich noch tiefer:
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung: Verkleinerung von LEAG-Tagebauen in jedem Fall notwendig
Am 1. September stellte das Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung e. V. (DIW) im sächsischen Landtag eine Studie zur Bewertung des „Revierkonzeptes 2021“ der LEAG vor, die im Auftrag der Landtagsfraktion Bündnis90/Die Grünen erstellt wurde. Ziel war es, die Planung der LEAG unter energiewirtschaftlichen Aspekten auf Plausibilität zu prüfen. Dazu wurden unterschiedliche Szenarien zur Kraftwerksauslastung betrachtet. Zu den Kernergebnissen der Studie erklärte Prof. Dr. Pao-Yu Oei vom DIW und Co-Autor der Studie:
„Unsere Studie zeigt, dass selbst bei maximal denkbarer Auslastung der Kraftwerke kein Kohlebedarf besteht, der die Inanspruchnahme des Sonderfelds Mühlrose rechtfertigt. Im Gegenteil, es sind sogar weitere Tagebauverkleinerungen im Lausitzer Revier notwendig. Dies gilt selbst im Falle eines späten Kohleausstiegs im Jahr 2035 oder 2038.“
Spiegel und Correctiv ausführlich über den LEAG-Oligarchen
Die aktuelle Ausgabe des Spiegels (26/2021) widmet sich in einem zweiseitiges Artikel dem tschechischen Milliardär Daniel Křetinský, dem Eigentümer des EPH-Konzerns und damit der LEAG. Der Artikel „Der Schrotthändler und sein Imperium“ versucht die Strategie des Investors zu beleuchten. Dafür wurde auch eines der wenigen Interviews mit Křetinský geführt, der ansonsten als medienscheu gilt. (Artikel hinter Bezahlschranke) Am 29. Juni veröffentlichte das Recherchenetzwerk Correctiv seine Recherche „Kohleausstieg: Das Milliardengrab der Lausitz“. Hier stehen die Folgekosten der LEAG-Tagebaue im Mittelpunkt, die auf die Steuerzahler*innen abgewälzt zu werden drohen. Neben zahlreichen anonymen Informanten aus Behörden und Ministerien kommt auch Dr. Martin Kühne von der Umweltgruppe Cottbus zu Wort.
Proschimer Bürger*innen und GRÜNE LIGA nehmen Stellung zu Braunkohle-Beihilfen
LEAG kann nicht für fremdes Eigentum entschädigt werden
 Mehrere Einwohner*innen von Proschim sowie das Umweltnetzwerk GRÜNE LIGA haben in einer Stellungnahme an die EU-Kommission die geplanten Milliardenentschädigungen für den Kohleausstieg kritisiert. Die LEAG könne nicht für die Verschonung fremden Eigentums entschädigt werden. Die EU-Kommission hatte zuvor starke Zweifel an der im deutschen Kohleausstiegsgesetz vorgesehenen Zahlung von 1,75 Milliarden Euro an die LEAG angemeldet. Vor einer Entscheidung können bis zum 7. Juni alle Beteiligten Stellung nehmen.
Mehrere Einwohner*innen von Proschim sowie das Umweltnetzwerk GRÜNE LIGA haben in einer Stellungnahme an die EU-Kommission die geplanten Milliardenentschädigungen für den Kohleausstieg kritisiert. Die LEAG könne nicht für die Verschonung fremden Eigentums entschädigt werden. Die EU-Kommission hatte zuvor starke Zweifel an der im deutschen Kohleausstiegsgesetz vorgesehenen Zahlung von 1,75 Milliarden Euro an die LEAG angemeldet. Vor einer Entscheidung können bis zum 7. Juni alle Beteiligten Stellung nehmen.
„Die Angaben der LEAG gegenüber der Europäischen Kommission zeigen endgültig, dass wir Proschimer Bürgerinnen und Bürger nur noch als Spekulationsobjekt missbraucht wurden, um für ein längst unrealistisch gewordenes Bergbauprojekt noch eine Milliardenentschädigung zu erlangen. Statt Staatsgeldern an den Bergbaukonzern müsste die LEAG uns Betroffene für die jahrzehntelang fehlende Planungssicherheit entschädigen.“ sagt Günter Jurischka, der einer der Unterzeichner des Briefes ist.
Braunkohlenausschuss lässt keine Gäste in die riesige Stadthalle
Am 15. April tagt der Brandenburgische Braunkohlenausschuss in der Stadthalle Cottbus. Dabei stellt die LEAG ihr neues Revierkonzept vor und muss sich den Fragen der Ausschussmitglieder dazu stellen. Danach wird das Verfahren zur Änderung des Braunkohlenplanes Tagebau Welzow-Süd ebenso besprochen wie der Umgang mit dem „Drei-Seen-Konzept“ der LEAG zum Tagebau Jänschwalde. Zudem informiert die LMBV über den Stand der Braunkohle-Sanierung und es wird erstmals von der Arbeit der Bergschadens-Schiedsstelle berichtet.
LEAG-Eigner in Alaska verunglückt
Der tschechische Milliardär Petr Kellner ist am 27. März bei einem Hubschrauber-Absturz in Alaska ums Leben gekommen. Kellner gehörte über seine Firma PPF praktisch die Hälfte des Kohleunternehmens LEAG. Der als reichster Tscheche bekannte Kellner war in Alaska zum sogenannten Heli-Skiing unterwegs, bei dem sich Skifahrer mit dem Hubschrauber auf Berggipfeln absetzen lassen, um dann durch unberührten tiefen Pulverschnee zu fahren. Das ist in den Alpen aus Umweltschutzgründen überwiegend verboten. "Eine unglaubliche Tragödie", zitiert die Sächsische Zeitung den tschechischen Regierungschef Andrej Babiš. In den sozialen Medien habe es aber auch negative Kommentare gegeben wie: "Was machte Kellner in Alaska, während andere wegen des Corona-Lockdowns kaum das Haus verlassen dürfen?" Auswirkungen des Todesfalles auf die Unternehmenspolitik der LEAG sind unwahrscheinlich, da dieses Geschäft von Anfang an von Daniel Křetínský, dem Gründer der EPH-Gruppe und damit zweiten privaten LEAG-Eigner organisiert wurde.