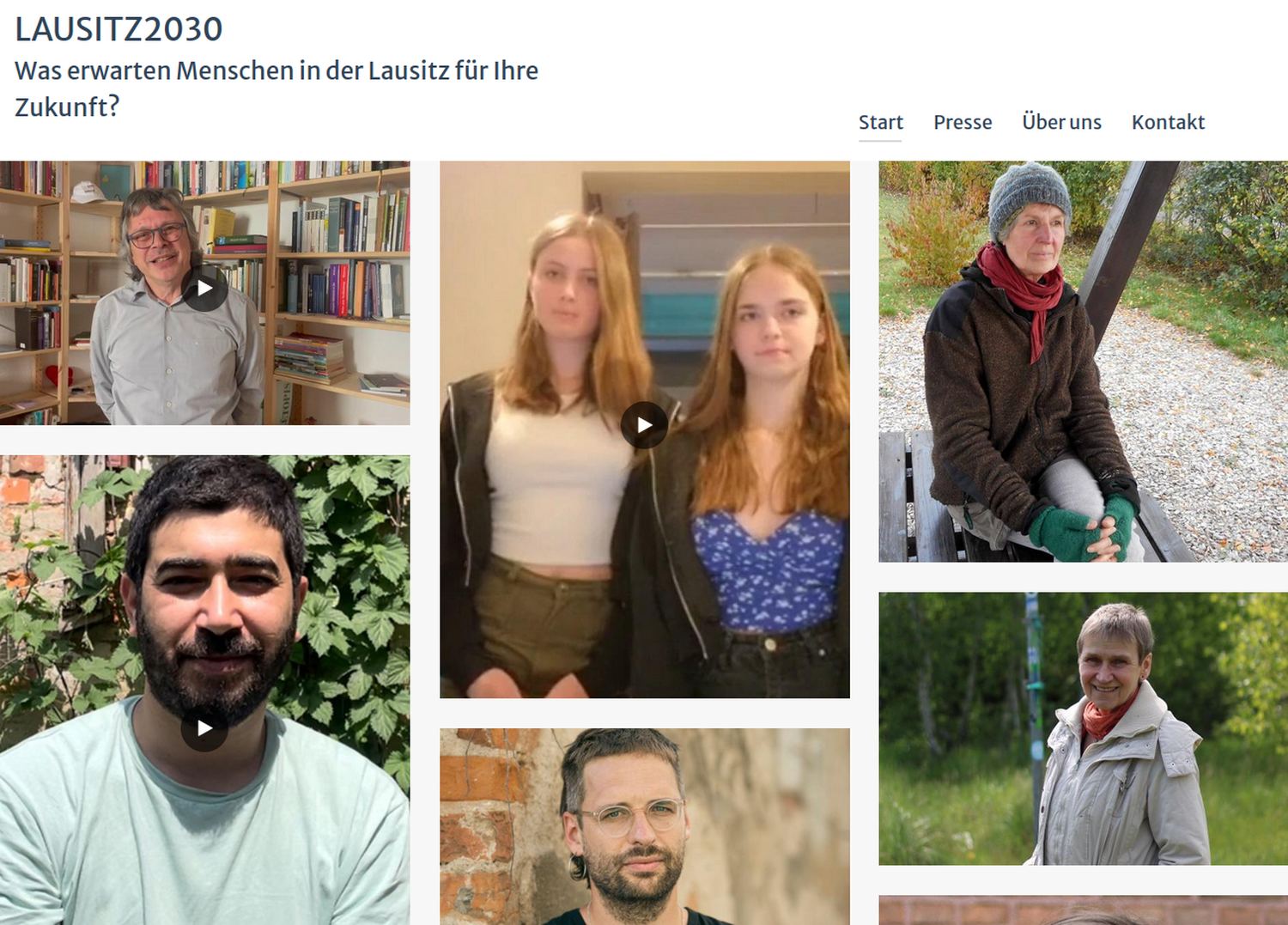Energiepolitik
Hier gibt es regelmäßig aktualisierte Meldungen zur Energiepolitik mit Schwerpunkt auf die Lausitzer Kohle.
Kohleverstromung geht aufgrund gestiegener CO2-Preise zurück
(Kohlerundbrief vom 8. oktober 2019:) Der CO2-Preis hat sich in den letzten zwölf Monaten auf ca. 25 Euro pro Tonne vervierfacht, die Stromerzeugung aus Braunkohle ging um 28 % zurück. Auch in Boxberg, Schwarze Pumpe und Jänschwalde werde deshalb zurzeit deutlich weniger Braunkohle verbrannt als üblich. Das berichtete unter anderem der MDR in der letzten Woche. Da stellt sich die Frage, wie sehr die LEAG wirklich unter dem Stillstand eines ihrer vier Tagebaue leidet oder ob sie nicht auch ohne Gerichtsentscheidung den Abbau deutlich verlangsamen müsste. Die Gerüchte, man prüfe den Tagebau Jänschwalde aus Kostengründen gar nicht wieder anzufahren, entstehen in dieser Situation fast schon zwangsläufig. Verlässliche Quellen dazu liegen uns aber bisher nicht vor.
Block E vom Netz: Stromkunden vergolden Kraftwerksstilllegung in Jänschwalde
(Kohlerundbrief vom 8. oktober 2019:) Am 1. Oktober ging der Blockes E des Kraftwerkes Jänschwalde in die Sicherheitsbereitschaft. Die GRÜNE LIGA fordert, bei künftige Kraftwerksstillegungen den Betreibern keine Geschenke mehr zu machen. Denn der LEAG-Konzern wird für die Abschaltung fürstlich von der Bundesregierung belohnt. Wir hoffen, dass das Unternehmen die jährlich dreistelligen Millionenbeträge tatsächlich in der Region verwendet. Die Mahnwache der Mitarbeiter darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass mit der Abschaltung ein Vorschlag der Gewerkschaft IGBCE umgesetzt wurde. Mit Blick auf die bevorstehenden Verhandlungen zwischen LEAG und Bundesregierung über den Zeitpunkt der Abschaltung weiterer Blöcke müssen künftige Deals preiswerter und transparenter für Steuerzahler und Stromkunden werden. Während die Region beim Strukturwandel unterstützt werden muss, darf es keine Geschenke an die zwei privaten LEAG-Eigentümer geben. Insgesamt fließen 1,61 Milliarden Euro für insgesamt 2,7 Gigawatt Sicherheitsbereitschaft an die Kraftwerksbetreiber, damit etwa 600 Millionen Euro an die LEAG.
Brandenburg verhandelt und Sachsen hat sondiert
(Kohlerundbrief vom 8. Oktober 2019:) Nachdem wir am 20. September unsere Kritik am Brandenburger Sondierungsergebnis formuliert haben, laufen derzeit die Koalitionsverhand lungen. Ob auch die neue Koalition die Menschen in Proschim zum Spekulationsobjekt für die Oligarchen Kretinský und Kellner machen will, sollte sie dabei noch einmal gründlich prüfen. Ohne eine Abänderung des Braunkohleplanes Welzow Süd II gibt es keine Planungssicherheit für Proschim. Auch in Sachsen formiert sich eine Kenia-Koalition aus CDU, SPD und Grünen, die am 4. Oktober ihr Sondierungsergebnis vorlegte. Dabei zeichnen sich zu den Lausitzer Tagebauen ähnliche Probleme ab wie in Brandenburg.
lungen. Ob auch die neue Koalition die Menschen in Proschim zum Spekulationsobjekt für die Oligarchen Kretinský und Kellner machen will, sollte sie dabei noch einmal gründlich prüfen. Ohne eine Abänderung des Braunkohleplanes Welzow Süd II gibt es keine Planungssicherheit für Proschim. Auch in Sachsen formiert sich eine Kenia-Koalition aus CDU, SPD und Grünen, die am 4. Oktober ihr Sondierungsergebnis vorlegte. Dabei zeichnen sich zu den Lausitzer Tagebauen ähnliche Probleme ab wie in Brandenburg.
ZEIT online: DDR-Umweltbewegung und Fridays For Future
(Kohlerundbrief vom 2. September 2019:) Der ZEIT-online-Beitrag über die Baumpflanzaktionen der DDR-Umweltbewegung fragt auch nach Parallelen zu Fridays for Future.
Brandenburg und Sachsen haben gewählt: kein Kohle-Bonus für die AfD
(Kohlerundbrief vom 2. September 2019:) Zur Analyse des Wahlergebnisses ließen sich viele Seiten verfassen. Da das aber schon viele andere tun, konzentrieren wir uns darauf, den oft behaupteten Zusammenhang von Kohlepolitik und den Ergebnissen von AfD und Grünen jetzt mal an den harten Zahlen zu überprüfen.
In Brandenburg haben die Zeitungskommentatoren sich in den letzten Wochen so sehr darin gefallen, die Grünen hoch- und die SPD runterzuschreiben, dass es sich schon etwas von der Realität entfernte. Das weiß man jetzt nach dem Wahlabend. Dennoch erreichen die Grünen mit 10,8 % das bisher beste Ergebnis in einem ostdeutschen Flächenland. Dass sie auch in der Lausitz deutlich dazugewinnen, ist durchaus mitteilenswert, nachdem der Kohleausstieg eine zentrale Rolle in ihrer Wahlkampagne gespielt hat. So haben die Grünen die absolute Stimmenzahl in beiden Cottbuser Wahlkreisen mehr als verdoppelt und kommen dort auf 8,6 bzw. 7,9 %. Im Spree-Neiße-Kreis fallen die Zugewinne verhaltener aus, sind aber trotzdem vorhanden.
Forderungskatalog der Tagebaubetroffenen zur Landtagswahl in Brandenburg und Sachsen
(Kohlerundbrief vom 28. August 2019:) Die Umweltgruppe Cottbus hat Forderungen der Lausitzer Tagebaubetroffenen an die künftigen Regierungen in Brandenburg und Sachsen veröffentlicht. Danach müssen neue Abbaugebiete wie Welzow II und das Sonderfeld Mühlrose sofort ausgeschlossen und die von den laufenden Tagebauen ausgehenden Probleme entschlossen minimiert werden. Die Forderungen betreffen beispielsweise die Verkleinerung der Tagebaue Jänschwalde und Nochten, den Umgang mit Folgekosten, Bundesratsinitiativen zur Änderung des Berggesetzes oder den Wasserhaushalt der Region.
Wir fordern schon seit Jahren, dass künftige Tagebauseen, etwa beim Tagebau Nochten, so umgeplant werden, dass sie nicht durch zusätzliche Verdunstungsverluste den Wassermangel im Spreegebiet verschärfen. Nach dem Dürrejahr 2018 sollte das Thema auch im Bewusstsein der Landespolitiker angekommen sein. Die Seen wirken sich über Jahrhunderte aus, da dürfen kurzfristige Gewinne der LEAG keine Rolle spielen. Insgesamt formuliert die Umweltgruppe acht Forderungen an die brandenburgische und elf an die sächsische Regierung. Unsere Analyse der Wahlprogramme brandenburgischer Parteien bleibt natürlich weiterhin aktuell.
Forderungen Brandenburg
Forderungen Sachsen