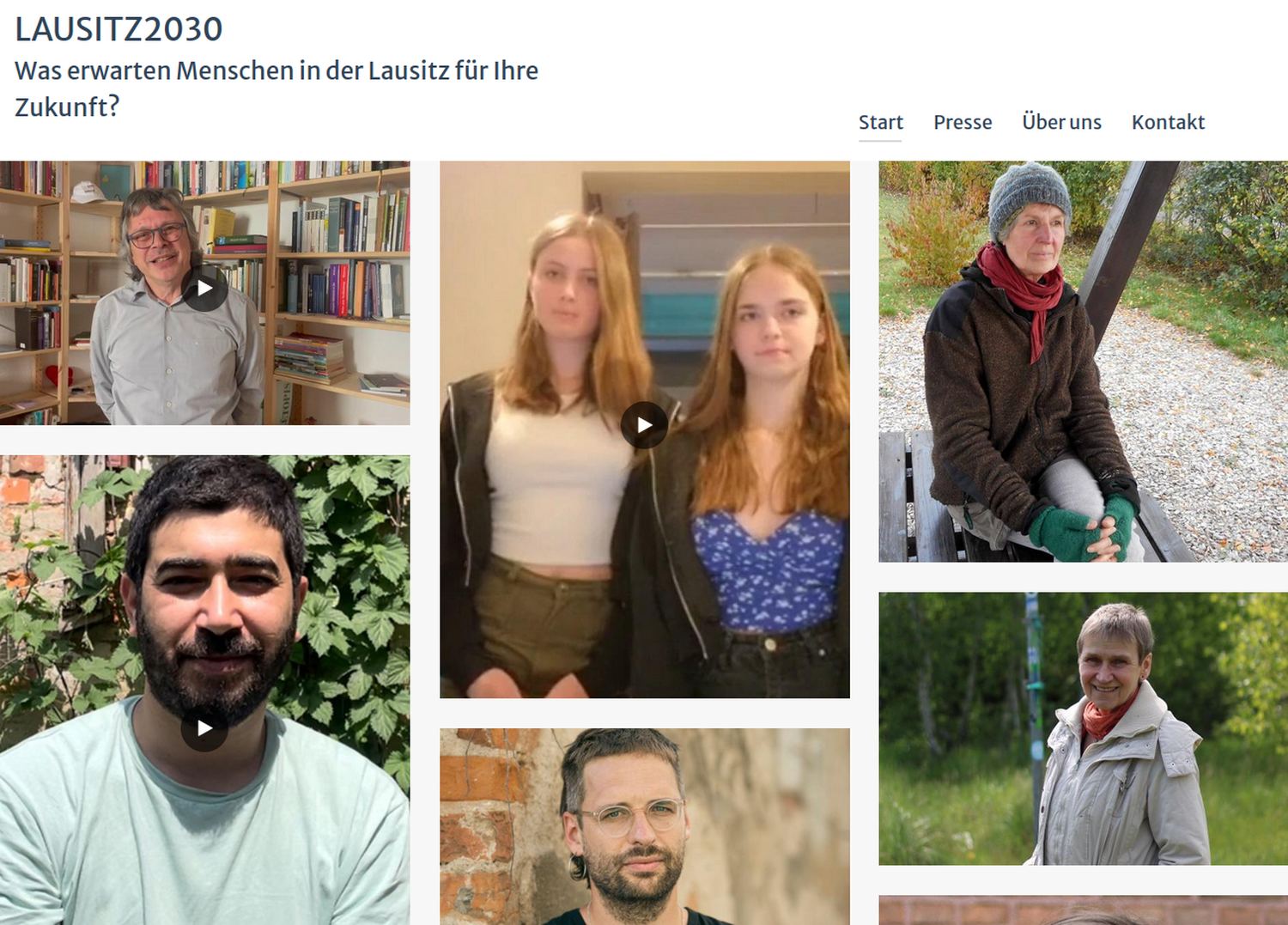Genehmigungen zum „Cottbuser Ostsee“ werden wegen Rutschungen überarbeitet
 Bei der gestrigen Sitzung des Brandenburgischen Braunkohlenausschusses stand eine „Information zu den Sanierungsarbeiten an den Böschungen des Cottbuser Ostsees“ auf der Tagesordnung, über die auch der rbb berichtete.
Bei der gestrigen Sitzung des Brandenburgischen Braunkohlenausschusses stand eine „Information zu den Sanierungsarbeiten an den Böschungen des Cottbuser Ostsees“ auf der Tagesordnung, über die auch der rbb berichtete.
Zunächst berichtee ein Vertreter der LEAG. Nachdem es an gewachsenen Ufer des Nordrandschlauches durch Wind und Wellen zu Kliffbildungen gekommen war, hatte die LEAG begonnen, auf 7 Kilometern Länge das Ufer erneut abzuflachen. Bei diesen Arbeiten sei es auf 100 Meter Breite zu einer Rutschung mit einer Rückgriffweite von 30 Metern gekommen. Die Ursachen sollen nun durch weitere Erkundungsbohrungen ermittelt werden. Man werde in Abstimmung mit der Bergbehörde eine Sanierungstechnologie vorschlagen und diskutieren.
„Cottbuser Ostsee“: Verdunstungsverlust wird in diesem Sommer steigen
 Erstmals konnte der ehemalige Tagebau Cottbus-Nord über mehrere Monate mit der Wassermenge geflutet werden, die der Zuleiter hergibt. Die bevorstehende geschlossene Wasserfläche wird öffentlich gefeiert, als wäre der See damit praktisch schon voll. Er fülle sich „im Rekordtempo“ war in den letzten Monaten mehrfach zu lesen. Mindestens zwei Dinge werden dabei vergessen:
Erstmals konnte der ehemalige Tagebau Cottbus-Nord über mehrere Monate mit der Wassermenge geflutet werden, die der Zuleiter hergibt. Die bevorstehende geschlossene Wasserfläche wird öffentlich gefeiert, als wäre der See damit praktisch schon voll. Er fülle sich „im Rekordtempo“ war in den letzten Monaten mehrfach zu lesen. Mindestens zwei Dinge werden dabei vergessen:
Cottbuser Seeufer auch im Oktober wieder gerutscht
Seit Juni 2023 wurde das Ufer des Cottbuser Ostsees im Bereich des Nordrandschlauches von der LEAG auf einer auf einer Länge von etwa 4,2 Kilometer nachsaniert. Und genau dort kam es Mitte Oktober kurz nach der Sanierung erneut zu einer Rutschung. Öffentlich bekannt wurde das erst einen Monat später durch einen Bericht der Lausitzer Rundschau vom 17. November(€).
Bergamt will Sicherheitskorridor um den Cottbuser Ostsee
Am 19. September berichtete die Lausitzer Rundschau, das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe (LBGR) empfehle am Cottbuser Ostsee dringend einen Sicherheitskorridor von 50 bis 75 Metern vom geplanten Ufer frei von Bebauungen zu lassen. Die Leag selbst wolle lediglich „versuchen, die im Planfeststellungsbeschluss definierten Ufer zu halten“. Arbeiten im Bereich des Auslaufbauwerkes, die bisher 2026-28 geplant waren, werden um vier Jahre nach hinten verschoben, weil ein bestimmter Wasserstand abgewartet werde. Das Ufer bei Schlichow werde über zwei Jahre neu gestaltet, wozu unter anderem eine Rütteldruckverdichtung nötig sei. Diese findet sonst vor allem auf der gekippten Seite der Tagebauseen Anwendung. Die Verdichtungsarbeiten in direkter Nachbarschaft zum Ort drohen nun zu Schäden an den Häusern zu führen. Gutachter sollen die Bausubstanz nun vor Beginn der Arbeiten erfassen.
Cottbuser Seeufer Mitte Mai erneut gerutscht
Etwas verspätet reichen wir die folgende Meldung nach: Schon am 1. Juni hatte die LEAG in einer Pressemitteilung über eine erneute Rutschung am Tagebau Cottbus-Nord („Cottbuser Ostsee“) informiert: „Der für diesen Sommer angekündigte Beginn der Sanierungsarbeiten im Bereich des Schlichower Damms muss (...) verschoben werden. Grund ist eine neue Mitte Mai aufgetretene Rutschung rund 400 Meter nordwestlich des bereits im Jahr 2022 durch Rutschungen geprägten Uferbereichs seeseitig des Schlichower Damms.“ Die Rutschung „mit einer Breite von 40 Meter und einer Rückgriffweite von 20 Metern in das Uferprofil“ liege im ohnehin schon gesperrten Bereich. Man werde sich umgehend der Klärung der Ursache widmen.
Statement der EU-Generalanwältin: Planfeststellung zum Cottbuser Ostsee ist offenbar rechtswidrig
Ende Februar nahmen die Frankfurter Wasserbetriebe nach einer außergerichtlichen Einigung mit der und die LEAG ihre Klage gegen die Planfeststellung des Cottbuser Tagebausees zurück. (Wir berichteten) Das geschah kurz bevor die zweite Verhandlung am Europäischen Gerichtshof stattgefunden hätte, den das Verwaltungsgericht Cottbus zur Auslegung des angerufen hatte um zu klären, wie die Wasserrahmenrichtlinie zum Thema Trinkwasserschitz auszulegen ist.
Der Schlussantrag der Generalanwältin am Europäischen Gerichtshof wurde dennoch veröffentlicht. Die von der FWA beauftragte Anwaltskanzlei hat ihn auf ihrer Homepage zusammengefasst und verlinkt. Dabei wird schnell klar, warum die LEAG sich offenbar zur Übernahme von Kosten der Wasserbetriebe veranlasst sah: Die Generalanwältin formuliert:
Rutschungen am Ostsee: Bleibt Stadt Cottbus auf den vom Tagebaubetreiber verursachten Kosten sitzen?
 Der Cottbuser Ostsee wurde stets mit großer Geste als eine Art Geschenk des Bergbaus an die Stadt vermarktet. Nun scheint er schon wieder mehr Steuergeld zu kosten als ursprünglich gedacht. Obwohl die Standsicherheitsprobleme offenbar auf ein fehlerhaftes Baugrundgutachten des Tagebaubetreibers zurückgehen, drohen die Kosten für die Sanierung der Kaimauer an der Kommune hängenzubleiben. Es geht um mindestens 600.000 Euro.
Der Cottbuser Ostsee wurde stets mit großer Geste als eine Art Geschenk des Bergbaus an die Stadt vermarktet. Nun scheint er schon wieder mehr Steuergeld zu kosten als ursprünglich gedacht. Obwohl die Standsicherheitsprobleme offenbar auf ein fehlerhaftes Baugrundgutachten des Tagebaubetreibers zurückgehen, drohen die Kosten für die Sanierung der Kaimauer an der Kommune hängenzubleiben. Es geht um mindestens 600.000 Euro.
Kohlekonzern LEAG vermeidet Grundsatzurteil des Europäischen Gerichtshofes
Verursacher LEAG zahlt endlich für Sulfatbelastung im Frankfurter Trinkwasser
 Cottbus, 28.02.2023. Das Umweltnetzwerk GRÜNE LIGA bedauert, dass es zum Cottbuser Tagebausee vorerst kein Grundsatzurteil des Europäischen Gerichtshofes geben wird. LEAG und Wasserversorger FWA haben sich offenbar auf eine Zahlung in Millionenhöhe geeinigt und ihren Rechtsstreit so beendet. Andere Verfahren zum Tagebau Cottbus-Nord bleiben dagegen bei den Gerichten anhängig. Die Flutung des Sees wird aufgrund von Wassermangel auch weiterhin immer wieder unterbrochen.
Cottbus, 28.02.2023. Das Umweltnetzwerk GRÜNE LIGA bedauert, dass es zum Cottbuser Tagebausee vorerst kein Grundsatzurteil des Europäischen Gerichtshofes geben wird. LEAG und Wasserversorger FWA haben sich offenbar auf eine Zahlung in Millionenhöhe geeinigt und ihren Rechtsstreit so beendet. Andere Verfahren zum Tagebau Cottbus-Nord bleiben dagegen bei den Gerichten anhängig. Die Flutung des Sees wird aufgrund von Wassermangel auch weiterhin immer wieder unterbrochen.
„Es war höchste Zeit, dass der Kohlekonzern als Verursacher der Sulfatbelastung wenigstens für einen Teil der Folgekosten zahlt. Leider wird damit eine grundsätzliche Klärung durch den europäischen Gerichtshof vermieden, welchen Stellenwert die Trinkwassergewinnung gegenüber den Bergbauinteressen hat. Angesichts absehbarer weiterer Folgeschäden ihrer Tagebaue hat die LEAG eine gerichtliche Klärung offenbar vermeiden wollen.“ bewertet René Schuster von der GRÜNEN LIGA den geschlossenen Vergleich.